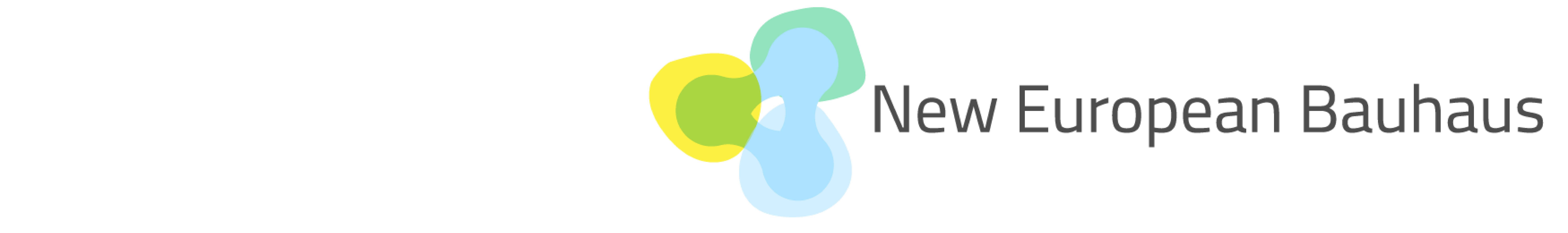Performativität – Emanzipation und die Freiheit in der Stadtluft

DQDS at bauhaus reuse, Berlin, 2017, © zukunftsgeraeusche
Prof. Dr. Uwe Wirth, “Performativität – Emanzipation und die Freiheit in der Stadtluft?”
stellt einen Zusammenhang her zwischen
Erstens dem etwas nebulösen Großbegriff der Performativität, zweitens, dem Streben nach Emanzipation – ein Prozess, der seit der Neuzeit (und dann natürlich vor allem in der Epoche der Aufklärung) in allen gesellschaftlichen Bereichen Raum greift, und drittens dem Schauplatz, an dem das Streben nach Emanzipation eingelöst wird: die Stadt.
Klar ist, dass dabei der bekannte Grundsatz “Stadtluft macht frei” Pate gestanden hat – ein Grundsatz, den Max Weber in seinen Überlegungen zu Wirtschaft und Gesellschaft explizit erwähnt, wenn es um die Rolle der frühneuzeitlichen Städte geht – und hier insbesondere um die, wie er schreibt, “Durchbrechung des Herrenrechts”. Damit steht der Grundsatz “Stadtluft macht frei” für eine Emanzipation von dem vermutlich mühseligsten Aspekt der Feudalherrschaft: der Fronarbeit als einer Form der Steuerlast, die Bauern an ihren Feudalherren zu entrichten hatten.
Die Freiheit der Stadtbürger bestand demgegenüber darin, dass sie diese Arbeit nicht mehr leisten mussten, und die Neubürger der Städte: Unfreie, Leibeigene, die in die Städte kamen (häufig flüchteten sie, um sich dem Zwang zur Fronarbeit zu entziehen) – diese Neubürger wurden nach Jahr und Tag, die sie innerhalb der Stadtmauern zugebracht hatten, zu Freien. In eben diesen Sinne macht Stadtluft – nachdem sie 366 Tage eingeatmet wurde – frei.
Natürlich war dieser Grundsatz für die Feudalherren, die ihre Herrschaft auf dem Land, in Dörfern, aber auch in sogenannten Fürstenstädten ausübten, ein Dorn im Auge. Wer in die Stadt floh war genau genommen ein Steuerflüchtling. Und so kam es zwischen Stadtbürgerschaft und Feudalherrschaft zu langwierigen – zum Teil auch gewaltsamen – Auseinandersetzungen.
Mit anderen Worten: Der Grundsatz “Stadtluft macht frei” war hoch umstritten – und erwies sich genau aus diesem Grund bis ins 19. Jahrhundert hinein als Politikum.
Zugleich zeigt sich aber auch schon bei diesem sehr rudimentären geschichtlichen Exkurs, dass die Stadt, genauer gesagt, das Betreten der Stadt, Teil einer emanzipatorischen Geste, ja eines emanzipatorischen Aktes ist.
Wer in die Stadt geht, um frei zu werden, der vollzieht mithin eine Art Unabhängigkeitserklärung.
Man könnte also sagen, dass der Grundsatz “Stadtluft macht frei” eigentlich heißen müsste: Der Wechsel von Landluft zu Stadtluft macht frei, denn auf dem Land herrschen die Feudalherren, während in der Stadt die Bürgerschaft die Regeln der Herrschaft selbst aushandelt – und insofern die Grundsätze ihrer Herrschaft selbst konstituiert.
Nun gibt es nach Weber aber noch einen zweiten Grund, warum Stadtluft frei macht, den er ebenfalls in Wirtschaft und Gesellschaft expliziert: Der Grund ist, dass in der Stadt – anders als auf dem Land oder in einem Dorf – die (ich zitiere Max Weber), “sonst dem Nachbarverband spezifische, persönliche gegenseitige Bekanntschaft der Einwohner miteinander fehlt.” (727)
Die Anonymität der Stadt ist dabei das Resultat ihrer Größe – Weber spricht von einem “quantitativen Merkmal”. Heißt: Je größer die Stadt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich die meisten Stadtbewohner nicht persönlich kennen.
Diese Unpersönlichkeit impliziert zunächst einmal, dass aufgrund des Mangels an persönlichen Beziehungen zu den Nachbarn auch die Sozialkontrolle nachlässt. Mit anderen Worten: Stadtluft macht frei, weil Stadtluft anonym macht.
In eben diesem Sinne schreibt Georg Simmel in seinem Essay über die “Großstädte und das Geistesleben” (1903), dass die ländlichen, dörflichen oder kleinstädtischen Gemeinschaften (Zitat) sehr viel “ängstlicher” über “die Leistungen, die Lebensführung und die Gesinnung des Individuums [wachen]” (125).
Umgekehrt gilt nach Simmel aber auch: “In dem Maß, in dem die Gruppe wächst – numerisch, räumlich, an Bedeutung und Lebensinhalten – […] lockert sich ihre unmittelbare innere Einheit […] und zugleich gewinnt das Individuum Bewegungsfreiheit, weit über die erste, eifersüchtige Eingrenzung hinaus” (124)
Diese, wie man sagen könnte, Emanzipation des Individuums von den Fesseln der eifersüchtigen und wachsamen Nachbarn, erhöht aber nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern sie ermöglicht auch die Abstraktion von den Singularitäten des Individuellen – und insofern impliziert das Unpersönliche der Großstadt eine Form der Überpersönlichkeit, aus der sich überhaupt erst so etwas wie ein Begriff von Allgemeinheit entwickeln lässt.
Der Motor dieses Prozesses ist eine Dialektik von “geistiger Distanz” und “Freiheit”.
Um dies klar zu machen, thematisiert Simmel den Grundsatz “Stadtluft macht frei”, wobei er diesen Grundsatz allerdings moduliert, indem er ihn auf das Verhältnis von Kleinstädter und Großstädter bezieht: So sei (Zitat) “heute in einem vergeistigten und verfeinerten Sinn, der Großstädter ‘frei’ im Gegensatz zu den Kleinlichkeiten und Präjudizierungen, die den Kleinstädter einengen” (126).
Der Preis dieser Freiheit ist die Gleichgültigkeit. So zeichnet sich die Großstadt durch eine “gegenseitige Reserve und Indifferenz” aus, durch eine, wie Simmels berühmte Formulierung lautet, “leise Aversion” gegenüber dem Nachbarn, “eine gegenseitige Fremdheit und Abstoßung” (123), die aber zugleich zum Gefühl der (Zitat Simmel) “Unabhängigkeit des Individuums” beiträgt.
Dasselbe Gefühl entsteht Simmel zufolge, sobald man sich in das “dichteste Gewühl der Großstadt” begibt, “weil die körperliche Nähe und Enge die geistige Distanz erst recht anschaulich macht” (126).
Der Begriff der “geistigen Distanz” ist Ausdruck jener unpersönlichen, überpersönlichen und im weitesten Sinne des Wortes bindungslosen Lebensform, die Simmel und Weber als die typische großstädtische Lebensform charakterisieren.
Dank der durch die “leise Aversion” gegen den Nachbarn entwickelten “geistigen Distanz” wird so etwas wie die Unabhängigkeit des Individuellen möglich, aber auch die Abstraktion von der Individualität des Nachbarn.
Parallel zu dem, was ich vorhin als “Unabhängigkeitserklärung” bezeichnet habe, die mit dem Akt des Betretens der Stadt vollzogen wird, birgt auch der Akt des Abstrahierens vom Individuellen hin zum Allgemeinen ein befreiendes Moment.
Tatsächlich bedeutet das lateinische Verb “abstrahere” ja auch das “sich losmachen, das sich befreien” von etwas. In diesem Falle: Das Sich-Befreien von engmaschigen, individuellen, persönlichen Beziehungsgeflechten.
Vermittelt über die Erfahrung, dass es in der Stadt möglich ist, dass auch einander Unbekannte miteinander leben können, wird Anonymität die Voraussetzung für ein Konzept von Allgemeinheit.
Diese Argumentation bekommt eine dezidiert architektonische Wendung, wenn Simmel schreibt, in der Großstadt böte sich, “in Bauten und Lehranstalten […] in den Formungen des Gemeinschaftslebens und in den sichtbaren Institutionen des Staates eine so überwältigende Fülle krystallisierten, unpersönlich gewordenen Geistes, daß die Persönlichkeit sich sozusagen dagegen nicht halten kann.” (130)
Die konkreten Bauten der Großstadt werden so zum sichtbaren Ausdruck von gesellschaftlichen Institutionen, die auf den Prinzipien eines Allgemeinheitskonzepts fußen – und damit auf dem Konzept eines unpersönlich gewordenen Geistes.
Zugleich wird aber auch das Großstadtleben selbst zum Motor für einen Prozess der erlebten Ent-Individualisierung von Lebensverhältnissen – ein Prozess, der gleichermaßen als befreiend und als befremdend erlebt wird: als Entwicklung hin zu überpersönlicher Allgemeinheit und unpersönlicher Anonymität.
Wie es scheint, haben wir es mit einer ambivalenten Konfiguration zu tun.
Ausgehend von Webers Idee, dass die Funktion der Stadt darin besteht, eine Lebensform zu ermöglichen, “in der einander Unbekannte miteinander leben”, beschreibt Dirk Baecker in einem Essay, das den Titel trägt: “Stadtluft macht frei” diese ambivalente Konfiguration folgendermaßen: “Diese Stadt lebt davon, Problem und Lösung des Problems, Norm und Abweichung von der Norm, eine Nachbarschaft des Miteinanders, Gegeneinanders, Nebeneinanders und Übereinanders zugleich zu sein. (5)
Genau aus dieser Ambivalenz, so Baeckers Argument, gewinnt die Stadt ihre “institutionelle Robustheit und Flexibilität” (ebd.) – eine Ambivalenz, die sich zugleich in der Gestaltung von Stadträumen manifestiert.
Die Qualität der Stadt als sozialer Form besteht demnach darin, dass sie (Zitat) “folgenreicher als andere soziale Formen Leerstellen einrichtet, die sichtbar und erlebbar noch nicht definiert sind, aber noch definiert werden können. Die Stadt inszeniert den Raum der Wahl, der Entscheidung, wen man aus welchem Anlass trifft oder nicht trifft, kann dies aber nur dann, wenn dieser Raum nur unspezifisch definiert ist.
Die öffentlich zugänglichen Plätze, ja die Öffentlichkeit schlechthin sind dieser Raum ebenso wie die kultischen Plätze […], die beide nicht etwa festschreiben, was auf diesen Plätzen geschieht, sondern stattdessen festschreiben, dass auf ihnen Entscheidungen getroffen werden können, die noch nicht getroffen sind”. (5)
Diese Beschreibung rückt einen Aspekt in den Mittelpunkt, der bisher eher subkutan mitschwang, nämlich dass der Städtische Lebensraum in dreifacher Hinsicht ein Möglichkeitsraum ist: Erstens, weil die Stadt ein Ort ist, an dem einander Unbekannte ihre Lebens- und Machtverhältnisse neu aushandeln können, aber auch immer wieder neu aushandeln müssen; zweitens, weil die Stadt Orte und Plätze schafft – funktionale Leerstellen – an denen diese Aushandlungsprozesse stattfinden können, drittens, weil die Stadt diese Orte und Plätze so in Szene setzt, dass sie als Orte und Plätze wahrgenommen werden, an denen Aushandlungsprozesse stattfinden können.
Aber ist es wirklich die Stadt, die hier agiert oder nicht vielmehr der Diskurs über die Stadt?
Eine Frage, der Michel Certeau in seinen Überlegungen zu urbanen Praktiken und dem Konzept der Stadt nachgeht, wobei er die Stadt selbst als ein anonymes Subjekt auffasst, das es ermöglicht, den städtischen Raum praktisch und diskursiv “zu erfassen und zu konstruieren” (184).
Auch für de Certeau ist die Stadt eine funktionale Leerstelle, ein Spielraum, der es erlaubt, ein (ich zitiere) “Spiel in einem System von definierten Orten” in Gang zu bringen, um die Neu-Definition anderer Orte in diesem System zu ermöglichen. Insofern macht die Stadt ebenso wie der Diskurs über die Stadt (noch einmal Zitat de Certeau) “Platz für die Leere” (201).
An dieser Stelle wird es nun höchste Zeit, den einen Begriff einzuführen, der gleichsam der Aufmacher des heutigen Abends ist: der Begriff der Performativität.
Ich werde mich darauf beschränken, einige grundlegende Unterscheidungen zu rekapitulieren, und zu versuchen, diese dann rück zu binden an die Beschreibungen der Funktion Stadt, die wir bei Weber, Simmel und Baecker kennen gelernt haben.
“Es ist durchaus verzeihlich, nicht zu wissen, was das Wort performativ bedeutet”, schreibt John Austin in seinem Aufsatz “Performative Äußerungen” im Jahr 1961: “Es ist ein neues Wort und ein garstiges Wort, und vielleicht hat es auch keine sonderlich großartige Bedeutung. Eines spricht jedenfalls für dieses Wort, nämlich, daß es nicht tief klingt” (305).
Die vielgestaltige Verwendbarkeit des Performanzbegriffs, ebenso wie seine Mehrdeutigkeit, haben maßgeblich zur akademischen Breitenwirkung des “garstigen Wortes” beigetragen.
Auf die Frage, was die Begriffe Performanz und Performativität bedeuten, geben Sprachphilosophinnen und Linguistinnen einerseits, Theaterwissenschaftler und Literaturtheoretiker andererseits sehr verschiedene Antworten.
Austin führt in How to do things with Words den Begriff des performative ein, um im Rahmen einer Auseinandersetzung mit Wittgensteins Sprachspiel-These eine Klasse von Sprachverwendungen zu bezeichnen, bei denen durch das Äußern bestimmter Worte, Handlungen vollzogen werden – von dieser Annahme leitet sich der Name der Sprechakt-Theorie ab.
So werden bei einer Heirat gleich mehrere Sprechakte vollzogen: etwa das “Jawort” der Eheleute vor dem Standesbeamten oder dessen Vollzugsformel: “Hiermit erkläre ich Euch zu Mann und Frau”.
Das Ensemble dieser Sprechakte verändert die Welt der Beteiligten Personen – und zwar weil sie bestimmte konventionale Prozeduren vollziehen.
Die sprachphilosophische Provokation performativer Äußerungen besteht darin, dass sich ihre Bedeutung nicht mit Bezug auf ihren Wahrheitswert, sondern nur mit Bezug auf sogenannte Gelingensbedingungen bestimmen lässt.
Im Gegensatz zu einer “konstativen Beschreibung” von Zuständen, die entweder wahr oder falsch ist, verändern “performative Äußerungen” durch den Akt des Äußerns Zustände in der sozialen Welt, das heißt, sie beschreiben keine Tatsachen, sondern sie schaffen soziale Tatsachen, indem sie durch das Äußern bestimmter Worte Handlungssequenzen einleiten.
So bewirkt das Versprechen der beiden Eheleute, sich in guten wie in schlechten Zeiten beizustehen eine Festlegung auf künftiges Handeln und der deklarative Sprechakt des Standesbeamten, “Hiermit erkläre ich Euch zu Mann und Frau”, bewirkt, dass sich die Eheleute nach dem Aussprechen dieser Worte im Zustand der Ehe befinden.
Die Bedeutung von Sprechakten leitet sich aus dem wechselseitig vorausgesetzten Wissen um den Verpflichtungscharakter des Sprechens ab.
Dabei rekurrieren Sprechakte auf ein Konzept von Sprache, das zwar auch intentional, vor allem aber konventional und funktional bestimmt ist.
Die intentionalen Rahmenbedingungen betreffen die individuelle aufrichtige Festlegung des Sprechers auf ein Verhalten: Mann und Frau müssen es ernst meinen mit ihrem Versprechen, sich in guten wie in schlechten Zeiten beizustehen.
Die institutionellen Rahmenbedingungen verweisen auf die sozialen Determinanten der Äußerungsbedeutung in konventionaler und funktionaler Hinsicht.
Entscheidend ist, ich zitiere Austin, “that the circumstances in which the words uttered should be in some way, or ways, appropriate” (1975: 8)
Das, was man beim Heiraten Meinen und Wollen kann, ist gerade nicht individuell verhandelbar. Insofern sind die intentionalen Rahmenbedingungen ihrerseits gerahmt von institutionell und konventionell festgelegten Bedeutungsfunktionen.
In diesem Sinne löst die Sprechakttheorie individuelle Intentionalität auf und überführt sie in überindividuelle (und das heißt natürlich auch: überpersönliche) Konventionalität.
So lauten die beiden grundlegenden Bedingungen dafür, dass Sprechakte funktionieren können (ich zitiere Austin): Erstens: “Es muß ein übliches konventionales Verfahren – an accepted conventional procedure – mit einem bestimmten konventionalen Ergebnis geben”, wobei “zu dem Verfahren gehört, daß bestimmte Personen unter bestimmten Umständen bestimmte Wörter äußern”. Zweitens: “Die betroffenen Personen und Umstände müssen im gegebenen Fall für die Berufung auf das besondere Verfahren passen”, das heißt: Sie müssen institutionell autorisiert sein.
Nur der Standesbeamte oder der Priester dürfen die Heirat vollziehen. Wenn der Rathaus-Pförtner oder der Messdiener die Zeremonie vollzieht, verunglückt der performative Akt bzw. erweist sich als nichtig.
Im Gegensatz zu dieser funktionalen Bestimmung, kann sich der Performanzbegriff aber auch auf die phänomenale Tatsache beziehen, dass etwas als Äußerung verkörpert wird.
So nimmt der Terminus performance im Rahmen von Noam Chomskys Grammatik-Theorie eine ganz andere Systemstelle ein als bei Austin. Chomsky führt die Differenzierung zwischen competence und performance ein, um die “Kenntnis” eines Sprecher-Hörers vom “aktuellen Gebrauch” der Sprache in konkreten Situationen zu unterscheiden.
Diese Verwendungsweise des Performanzbegriffs als Bezeichnung von Äußerungspraktiken inklusive ihrer materialgebundenen Medialität thematisiert nicht nur das, was hinter den sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen liegt, also die konventionale Funktion von Sprechakten, sondern sie thematisiert die Verkörperungsbedingungen von Äußerungen.
Die Verwendung dieses im weitesten Sinne des Wortes medialen Performanzbegriffs impliziert also einen an den Äußerlichkeiten der Verkörperungspraxis interessierten Blick, dem es um die Erkundung der verschiedenen Möglichkeiten geht, stimmlich, gestisch, schriftlich oder mit Hilfe von Bildern Sachverhalte darzustellen.
Hierher gehört vermutlich auch jene Vollzugsform von Performativa, die im Zentrum von Michel de Certeaus Auseinandersetzung mit der Sprechakt-Theorie in Die Kunst des Handelns steht: Der Akt des Gehens, schreibt er (ich zitiere), “der Akt des Gehens ist für das urbane System das, was die Äußerung (der Sprechakt) für die Sprache oder die formulierte Aussagen ist” (189).
Warum? Weil man beim Gehen – beim Spazieren, beim Flanieren – durch den Stadtraum eine “räumliche Realisierung” (ebd.) von Orten vornimmt, sie also durchs “Begehen” mit konstituiert – und weil man sich zugleich durch Akte des Gehens Räume aneignet. Dergestalt wird das Gehen zu einer beweglichen Verkörperungsform des Performativen.
Schließlich impliziert der Begriff “Performativität” aber auch den Aufführungscharakter von Äußerungen und Handlungen, so wie man es von dem englischen Begriff der performance her gewohnt ist.
Eben diese Verwendungsweise steht – wenig überraschend – für die Theaterwissenschaft im Zentrum des Interesses.
In ihrem Aufsatz “Grenzgänge und Tauschhandel” bezieht Erika Fischer-Lichte Theatralität und Performativität wechselseitig aufeinander, wobei sie vier Aspekte unterscheidet: Erstens die Performance als “Vorgang einer Darstellung durch Körper und Stimme vor körperlich anwesenden Zuschauern” (299), zweitens die Inszenierung als “spezifischer Modus der Zeichenverwendung in der Produktion” (ebd.), drittens die Korporalität als Aspekt, “der sich aus dem Faktor der Darstellung bzw. des Materials ergibt” (ebd.), und schließlich viertens die Wahrnehmung als Aspekt, “der sich auf den Zuschauer, seine Beobachtungsfunktion und -perspektive bezieht” (ebd.)
Hier wird Performativität zu einem Begriff, der sich nicht nur auf die Gelingens- und die Verkörperungsbedingungen, sondern auch auf die Inszenierungs-bedingungen von Kunst-Konfigurationen bezieht.
Allerdings nicht ausschließlich, denn Inszenierungen gibt es ja nicht nur in Kunst-Kontexten, sondern auch im öffentlichen Räumen: In Feierstunden des Parlaments, bei der Hochzeit von Promis und Potentaten, beim Sich-Zeigen auf Balkonen – sei es im Rahmen von Koalitionsverhandlungen, sei es im Rahmen von Volksansprachen. Aber natürlich haben auch Volksfeste und Demonstrationen auf öffentlichen Plätzen Inszenierungscharakter.
Und auch das bereits erwähnte Spazierengehen hat in gewisser Hinsicht Inszenierungscharakter – man spaziert auf der Flaniermeile der Stadt, um sich zu zeigen, um sich als Stadt-Bewohner in Szene zu setzen und unter den vielen Unbekannten von den wenigen Bekannten erkannt zu werden.
Unsere heutige Medien-Gesellschaft ist in ganz besonderem Maße eine Inszenierungsgesellschaft, die nicht nur von Inszenierungen durchzogen, sondern gleichsam von einer “Kultur der Inszenierung” angetrieben wird (ebd.).
Insofern kann man sagen, dass unser Leben durch ein Geflecht von performativen Sprechakten bestimmt wird: Und zwar zunächst einmal performativa im Sinne Austins, also Verträge, Konventionen, institutionelle Autorisierungen, die die Grundlage bilden für ein verbindlich geregeltes gesellschaftliches Zusammenleben.
Angefangen mit den Verkehrsregeln (etwa der roten Ampel, die wie ein direktiver Sprechakt funktioniert), bis hin zu Richtlinien für die Statik von Gebäuden, Mietverträgen für Privatwohnungen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Betrieb einer Würstchenbude oder eines Einkaufzentrums.
Aber natürlich geht es hier auch um “große” gesellschaftspolitische Fragen, etwa die Frage: soll die “Institution Ehe” auch für gleichgeschlechtliche Paare zur Verfügung stehen?
Begleitet und überlagert werden derartige performativen Sprechakte jedoch immer schon von Inszenierungsformen und -strategien, die den Charakter von Performances haben.
Dazu zählen die bereits genannten Feste, Umzüge, Kundgebungen, Demonstrationen, aber auch die Gebäude von Institutionen, in denen das Einhalten der Gelingensbedingungen bestehender Sprechakte überwacht wird, oder die Gelingensbedingungen von Sprechakten neu ausgehandelt werden: Die Polizei, die die Einhaltung direktiver Sprechakte kontrolliert. Das Gerichtsgebäude, wo über strittige Verträge oder Verstöße gegen Konventionen entschieden wird.
Das Parlamentsgebäude oder das Rathaus, wo über neue Konventionen oder Regeln verhandelt wird.
All diese Gebäude sind nicht nur Verkörperungen von Institutionen, sondern verwandeln die Orte, an denen sie stehen in Schauplätze: In eben diesem Sinne kann man dann mit Dirk Baecker sagen: “Die Stadt inszeniert den Raum der Wahl, der Entscheidung”.
Die Plätze, an denen Bedeutungsfunktionen von Sprechakten ausgeführt werden, sind zugleich Schauplätze von Performances: Plätze, an denen nicht nur etwas ausgeführt, sondern auch etwas aufgeführt – inszeniert – wird.
Nehmen wir nur, um beim Beispiel des Heiratens zu bleiben das Rathaus – oder vielleicht auch die Treppen vor dem Rathaus: Wenn dort im Standesamt – als gesellschaftspolitisches Novum – eine gleichgeschlechtliche Heirat vollzogen wird, dann werden die Treppen des Rathauses zur Bühne, auf der dieses gesellschaftspolitische Novum demonstrativ vorgeführt wird.
Folgt man Judith Butler, dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen: Dieses Spannungsverhältnis zwischen performativen Akten und Akten der Performance betrifft jeden Akt der Gender-Konstitution, denn der Körper ist, wie sie schreibt, “immer eine Verkörperung von Möglichkeiten, welche von historischen Konventionen konditioniert und beschränkt wird”.
Dergestalt erweist sich der ge-genderte Körper als performativer Körper, der Verkörperung und Inszenierung dieser Verkörperung zugleich ist.
Zusammenfassend könnte man vielleicht einfach sagen: Stadtluft macht performativ, und zwar in jeder der drei erwähnten Hinsichten: Stadtluft macht performativ aufgrund von Bedeutungsfunktionen, aufgrund von Verkörperungspraktiken und aufgrund von Inszenierungsformen.
Die entscheidende Frage ist nun aber, wie man dabei das Verhältnis von Performanz und Performance beschreibt: Ist es ein Verhältnis der Wechselwirkung – ist das eine die Begleiterscheinung des anderen – oder stehen Performanz und Performance in einem Spannungsverhältnis zueinander: Negiert eine Performance die Gültigkeit eines Performativs?
Wenn eine Hochzeit im Rathaus vom Standesbeamten vollzogen wird, dann handelt es sich um eine gültige Trauung. Und, so kann man hinzufügen: Wo es per Gesetz möglich ist, dass gleichgeschlechtliche Paare standesamtlich getraut werden, ist diese Trauung gültig. Wo dies nicht möglich ist, kann die Trauung nicht stattfinden, sie hat nicht den Charakter eines gültigen, institutionell autorisierten Sprechakts.
In beiden Fällen gilt jedoch auch: Wenn die Hochzeit auf einer Theaterbühne von einem Schauspieler vollzogen wird, der einen Standesbeamten spielt, wenn es sich also bloß um eine Performance handelt, dann ist die Trauung nicht gültig.
Warum?
Weil diejenigen, die die Worte “Ich will” und “hiermit erkläre ich Euch” geäußert haben, diese Worte nicht im Sinne der Sprechakt-Theorie ernst gemeint haben.
Austin würde sagen: Weil im zweiten Fall, bei einer Performance, dem Sprechakt jene “illokutionäre Kraft” fehlt, die er aufgrund seiner konventionalen Bedeutungsfunktion – das heißt: durch seine gesellschaftliche und institutionelle Legitimierung und Autorisierung haben muss.
Aber natürlich könnte man auch genau anders herum argumentieren und sagen: Jeder ausgeführte Sprechakt hat auch eine Schauseite – jedes performativ ist immer auch eine performance – und vielleicht ist es ja häufig so, dass die Eheleute die Eheschließung erst einmal durchspielen – dass sie proben, bevor sie ins Standesamt gehen – und erinnern sich dann, wenn es “ernst” wird, wie Schauspieler an ihre Probe.
Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man diese Frage – das Wechselverhältnis von performativa mit Geltungsanspruch und performances mit Inszenierungscharakter – wenn man diese Frage auf die Funktion Stadt überträgt.
Wie entstehen die Möglichkeitsräume, die Spielräume, die Leerstellen der Stadt? Wie lassen sich jene funktionalen Leerstellen einrichtet, die, wie es bei Baecker hieß, “sichtbar und erlebbar noch nicht definiert sind, aber noch definiert werden können”.
Nun ist der Begriff der Leerstelle, wenn es um Stadträume geht, sehr verführerisch. Man denkt sofort an Baulücken – an Leerflächen, für deren Gestaltung dann ein Stadtplanerischer Ideenwettbewerb ausgelobt wird.
Der Begriff der Leerstelle bezieht sich jedoch in erster Linie auf einen Möglichkeitsraum im Sinne eines noch nicht endgültig definierten Raums – also eines Freiraums im räumlichen und im konzeptionellen Sinne.
Die Begründung für die Möglichkeit von Leerstellen, die ihrerseits die Voraussetzung für das Entstehen der stadttypischen Freiheit ist, war bei Simmel und Weber, dass man in der Stadt mit Unbekannten zusammenlebt, der Freiraum also aufgrund fehlender Sozialbindung zustande kommt.
Wie lässt sich das im Rekurs auf Performanz-Theorien beschreiben?
Gehen wir noch einmal zurück zu den eingangs angestellten Überlegungen über das Verhältnis von Land und Stadt: Die Machtansprüche und die daraus abgeleiteten Gesetze der Feudalherrschaft könnte man, genau wie die Regeln, die in den freien Städten gelten, als performatives Regime bezeichnen.
Und man könnte sagen: Das Regime der Feudalherrschaft überwacht die Einhaltung von Performativen aus einem Eigeninteresse am Machterhalt.
Die Stadtbürgerschaft errichtet demgegenüber ihr eigenes performatives Regime und überwacht deren Einhaltung – allerdings mit dem primären Ziel, ihre Unabhängigkeit gegenüber der Feudalherrschaft zu bewahren.
Etwa, indem sie darauf dringt, das Prinzip der Autokephalie durchzusetzen – unsere Bürger – die Bürger der Stadt – dürfen nur vor unsere eigenen Gerichte gestellt werden: Wir haben die Gerichtshoheit als Zeichen unserer Unabhängigkeit.
Dabei impliziert der Wechsel vom Land in die Stadt einen Wechsel des performativen Regimes, das heißt: das eine Regime verliert seine Gültigkeit, sobald man sich innerhalb der Stadtmauern befindet – das andere wird gültig.
Allein durch das Eintreten in die Stadt vollziehe ich ein Performativ – ganz im Sinne von de Certeau, der die Akte des Gehens mit den Sprechakten in Analogie setzt: Das Betreten der Stadt wird zum deklarativen Akt, zu einer Unabhängigkeitserklärung. Zweiter Aspekt: Webers Definition der Funktion Stadt: Stadtluft macht frei, weil einander Unbekannte in der Stadt zusammenleben.
Damit dieses Zusammenleben gelingen kann, braucht es Übereinkünfte, die unabhängig sind von der Intentionalität einzelner Individuen. Es brauch geregelte, allgemeingültige Intentionalitäten, wie sie performative Sprechakte bereitstellen: Performative Sprechakte organisieren Intentionalitäten – sie definieren, das, was man Meinen und Wollen kann – im Rahmen überindividueller Funktionsbedeutungen.
Überindividuell heißt zugleich: überpersönlich und anonym. Eine Schablone, eine Handlungsmaske, ein intentionales Template, in die jeder passt, der die Gelingensbedingungen erfüllt.
Mit anderen Worten: wenn die Funktion Stadt darin besteht, dass sie Freiräume schafft, in denen Unbekannte miteinander zusammenleben, dann braucht sie die Bedeutungsfunktion von performativen Sprechakten, weil diese schablonenhaft vorgeben, was man meint und will, wenn man bestimmte Worte äußert und damit die Intentionalität von unbekannten Sprechern berechenbar – vorhersehbar macht.
Meine These wäre nun – und damit bin ich dann auch schon beim dritten und letzten Punkt – dass mit dem Aspekt der Performance und der Inszenierung diese Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit wieder in Frage gestellt wird.
Klar kann man sagen, dass jedes Ausführen von performativen Sprechakten bis zu einem gewissen Grade immer auch Inszenierungscharakter hat – doch beim Vollzug von Performativa wird die Performance eher als eine Begleiterscheinung gewertet.
Anders verhält es sich bei expliziten Inszenierungen: Hier wird mit Hilfe bestimmter Rahmungshinweise klargemacht, dass es nicht um den Vollzug von Sprechakten, sondern um das Vorführen oder Aufführen von Sprechakten geht.
Das heißt auch: Hier wird die Bedeutungsfunktion von performativen Sprechakten von ihren pragmatischen Konsequenzen entlastet – und eben diese Entlastung schafft einen Freiraum:
Einen Freiraum, um beispielsweise über die Funktionsweise von Sprechakten und über ihre Gelingensbedingungen nachzudenken.
Dieser, durch Inszenierungen angestoßene Prozess des Nachdenkens kann politisch werden – er kann dazu führen, dass über die Gelingensbedingungen von Sprechakten neu verhandelt wird.
Hier stellt sich die Frage, ob die Freiheit der Stadtluft und der Freiraum, der durch die Funktion Stadt geschaffen wird, nicht letztlich auf einer Ambivalenz gründet, nämlich dem ambivalenten Spannungsverhältnis zwischen Performativa und Performance.
Ich würde sagen: Ja!
Denn genau dieses Spannungsverhältnis eröffnet Freiräume und macht das Nachdenken über und Neuverhandeln von Konventionen und Gelingensbedingungen möglich.
Meine These wäre daher, dass die Funktion Stadt nicht nur im Zusammenleben von Unbekannten besteht, sondern im Initialisieren von ambivalenten Zuständen, die ihrerseits die Voraussetzung für funktionale Leerstellen sind.
Insofern könnte man sagen: Stadtluft macht frei, weil Stadtluft ambivalent macht.
Oder zugespitzt: Stadtluft gibt es überhaupt nur deshalb, weil im Rahmen von Städten permanent ambivalente Zustände möglich sind.